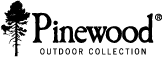Das Aussetzen von Wild: Zwischen Artenschutz und Abschießbelustigung

Das Aussetzen von Wild bereitet der Jagd Glanzlichter und Schattenseiten. Während einige Wildarten ohne das Engagement der Jäger ausgestorben wären, haben Einbürgerungen gebietsfremder Arten ökologische Katastrophen mit sich gebracht. Darüber hinaus ist das Aussetzen von Wild zum Zwecke des Abschusses gesellschaftlich geächtet und bringt die Jagd als eine Art der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen oft in Misskredit. Dieser zweiteilige Beitrag beleuchtet das komplexe Themengebiet rund um das Aussetzen von Wild.
Von Univ.-Prof. Dr. Klaus Hackländer
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, Universität für Bodenkultur Wien
Fotos: Ch. Böck, F. Fritsch
Teil 1: Begrifflichkeiten und Begehrlichkeiten
Unsere Wildtiere besitzen von Natur aus nur eine beschränkte Ausbreitungsfähigkeit. Diese wird heutzutage durch diverse Infrastrukturen (Autobahnen, Schnellzugtrassen, Uferverbauungen, Windkraftanlagen,…) noch weiter herabgesetzt. Das Ausbreitungspotential der Wildtiere ist aber gerade im Alpenraum durch die natürlichen Barrieren ohnehin sehr verlangsamt. Sind Wildtiere lokal ausgestorben, so bietet sich die künstliche Ansiedlung als Artenschutzmaßnahme an. In der Fachwelt unterscheidet man vier Ansiedlungstypen.
Die Wiedereinbürgerung (auch Wiederansiedlung) bezieht sich auf das Aussetzen von Individuen einer Art in einem Gebiet, in dem sie früher einheimisch war, später jedoch durch den Menschen ausgerottet wurde. Als Beispiel sei hier der Bartgeier in den Alpen genannt.
In vielen Jagdgebieten galt der zweite Typ des Aussetzens, die Bestandsstützung, als Teil der Hege. Sie umfasst das Aussetzen von Individuen einer Art in einem Gebiet, in dem eine Restpopulation vorhanden ist. Sie soll die Dichte in einem Gebiet erhöhen. Das Aussetzen der berüchtigten „Kistlfasanen“ ist natürlich nicht als Bestandstützung zu bezeichnen, da sie lediglich der Abschießbelustigung dient.
Als dritter Typ ist die Umsiedlung zu nennen. Hierbei werden Individuen einer Art in geeignete Biotope ausgesetzt, die innerhalb eines größeren Verbreitungsgebietes dieser Art liegen. In diesem gibt es aber keine geschlossene Population mehr, da die Art vielerorts lokal erloschen ist. Durch die Umsiedlung sollen die Lücken geschlossen werden und das Vorkommensgebiet verdichtet werden. So wurde z.B. der Habichtskauz im Bayerischen Wald, im Wienerwald und im Wildnisgebiet Dürrenstein ausgesetzt.
Als vierten Typ kennt man die Einbürgerung, bei der Individuen einer Art in einem Gebiet ausgesetzt werden, in der sie früher nicht vorkam. Oft wurden zum Zwecke der Jagd gebietsfremde Arten ausgesetzt, in Österreich gehören dazu z.B. das Sikawild oder das Muffelwild.

Nicht immer sind Einbürgerungen gelungen und haben zu selbst erhaltenden Populationen geführt. So konnten im 19. Jahrhundert zwar einige der zahlreiche Aussetzungsaktionen des Truthuhns in Österreich kurzfristig Erfolge erzielen, sie sind aber letztendlich alle wieder erloschen. Arten, die nach 1492 (Entdeckung Amerikas und Beginn des transatlantischen Warentransports) mit oder ohne Hilfe des Menschen in einem Gebiet etablieren konnten, werden als Neubürger bezeichnet. Diese gelten als invasiv, wenn sie in ihrer neuen Heimat zur Zerstörung von Lebensräumen führen und einheimische Arten verdrängen oder gar zum Aussterben bringen.
Es gibt wohl keine Neubürger, die keine negative Konsequenzen für unsere Ökosysteme mit sich gebracht haben, weshalb man immer von invasiven Neubürgern spricht (im Englischen invasive aliens). Aus diesen Gründen sind Einbürgerungen heutzutage untersagt. Insbesondere die Konvention über die Biologische Vielfalt (die Österreich 1994 ratifiziert hat) und die aktuelle Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (gültig ab 1. Jänner 2015) sind dabei zu nennen. Hiermit ist Österreich verpflichtet, ein nationales Überwachungs- und Monitoringsystem für jene invasiven gebietsfremden Arten zu etablieren, die von unionsweiter Bedeutung sind (z.B. Waschbär). Das Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft bereitet sich gerade darauf vor, mit Mag. Tanja Duscher die notwendigen wissenschaftlichen Arbeiten dazu zu übernehmen.

Im Alpenraum stechen zwei Wildarten hervor, deren heutige Verbreitung vor allem durch Aussetzungsaktionen bedingt ist. Die spannendste Geschichte ist wohl jene des Alpensteinbocks. Bereits im Mittelalter war dieser in Österreich weitgehend auf die westlichen Hohen Tauern und die Tiroler Gebirge beschränkt. Die kleine Eiszeit um 1500 setzte den Populationen stark zu. Der Bestand dünnte sich aus, nach Osten hin konnte sich bis in die frühe Neuzeit eine kleine Population im oberösterreichisch-steirischen Salzkammergut halten. Übernutzung der Bestände (u.a. wegen der medizinischen Bedeutung der Bezoare, des Blutes und des Horns) führte aber zum Aussterben des Steinwilds in Österreich am Ende des 18. Jahrhunderts. Zeitgleich verschwand dieses symbolträchtige Tier auch in der Schweiz. Letztendlich konnte es nur in den Grajischen Alpen überleben. Dort pachtete der italienische König Vittorio Emmanuele II. 58.000 ha im Gran Paradiso Massiv, stellte Wildhüter zum Schutz vor Wilderei ein und pflegte dort die nachhaltige Nutzung dieser kleinen Population. Jagd hat in der Vergangenheit nicht selten zur Rettung von Arten geführt. Viele Beispiele bezeugen, dass die Jagdleidenschaft des Adels für den Erhalt der Wildtiere von großer Bedeutung war. So konnte z.B. das Wisent im Jagdgebiet des russischen Zaren bzw. der polnischen Könige vor dem Aussterben bewahrt werden.
Den Weg zurück in den gesamten Alpenlebensraum fand der Steinbock mit Hilfe einer illegalen Aktion. Schweizer Bürger, die ihr Nationaltier wieder in den heimischen Alpen sehen wollten, engagierten Wilderer, Steinwildkitze im Gran Paradiso zu fangen. Diese wurden in Gehegen überführt und vermehrt. Bereits fünf Jahre nach den ersten Kitzlieferungen aus dem Aostatal, standen die ersten Steinböcke zur Wiederansiedlung auf Schweizer Boden bereit. Streng genommen war es jedoch eine Umsiedlung, da die Art ja im Verbreitungsgebiet nicht ausgestorben war. Man kann jedoch auch von einer lokalen Wiederansiedlung sprechen. Vielerorts wurde Steinwild in der Schweiz wieder erfolgreich etabliert. In Österreich erfolgten die ersten Aussetzungen im salzburgischen Blühnbachtal/Hagengebirge und an der Böswand/Hochschwab. Zwischen 1950 und 1980 wurde Steinwild an mindestens 40 weiteren Orten ausgesetzt, auch in Gebieten, in denen die Art ursprünglich nie vorkam (z.B. Hohe Wand/Niederösterreich). Mittlerweile wird der Bestand in Österreich auf ca. 4.500 Individuen geschätzt. Die nachhaltige Nutzung sichert die Bestandesdichte und gewährleistet somit die Erhaltung der Art.

Im Gegensatz zum Alpensteinbock kam das Alpenmurmeltier bis weit in die Ostalpen vor. Die Verbreitung wurde am Ende der Eiszeiten vor allem durch die zurückweichenden Gletscher und die darauffolgende Bewaldung beeinflusst. Nachdem das Murmeltier den Lebensraum oberhalb der Waldgrenze bevorzugt, zog sich der Nager in die Westalpen zurück und besiedelte dort neben dem Steinwild die hochgelegenen alpinen Matten und Wiesen mit Schwerpunkt in Salzburg und Tirol. Eine starke Übernutzung lokaler Restbestände (ebenfalls zur Gewinnung medizinischer Produkte) beschleunigte den Prozess der verinselten Verbreitung. Über die Anzahl der erlegten Murmel kann nur spekuliert werden, da die Wildart nie zu den Regalien gezählt wurde. Folglich gab es weder Regulierungen noch Aufzeichnungen. Erst 1911 wurde das Murmeltier in Österreich unter jagdgesetzlichen Schutz gestellt und dabei sogar der Hohen Jagd zugerechnet. Schon vorher, im Jahr 1860, gab es die ersten Aussetzungen in Österreich, nämlich am Mayrwipfel/Sengsengebirge und auf dem Riegelkar/Karwendel. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden 15 Aussetzungsaktionen dokumentiert, einen Boom erlebten die Aktivitäten vor allem nach 1950, mit einem Höhepunkt in den 1980er Jahren. Insgesamt wurden in dieser Zeit weitere 100 Aussetzungen beschrieben. Hinzu kommt eine nicht unbeträchtliche Zahl undokumentierter bzw. nicht genehmigter Aussetzungen. Heute finden wir das Murmeltier wieder flächendeckend in den Hochlagen der österreichischen Alpen.
Abgesehen von diesem vorbildlichen Engagement der Jagd für den Artenschutz, gibt es jedoch auch Kritik, wenn Wildarten ausgesetzt werden. In der Jagd wird vielerorts die Bestandsstützung als Hegemaßnahme gesehen. Bei genauer Betrachtung von diesen Maßnahmen z.B. beim Fasan stellt sich unweigerlich die Frage, warum Fasane zur Bestandsstützung in einem Revier ausgesetzt werden (dürfen), das einen geeigneten Lebensraum darstellt. Wenn der Lebensraum passt, sollte auch der Zuwachs entsprechend hoch sein, damit sich eine jagdliche Bewirtschaftung ausgeht. Wenn Fasane ausgesetzt werden, weil der Zuwachs ausbleibt, dann ist der Lebensraum nicht geeignet. In diesem Falle wäre es angebracht, zunächst jene Missstände zu beheben, die dem Fasan zusetzen. Dies kann z.B. geringe Deckung oder Äsung sein, die durch Lebensraumverbesserungsmaßnahmen wieder erhöht werden könnten. Oder der Druck durch Prädatoren ist zu hoch, was nach einer intensiveren Raubwildbejagung rufen würde. Beide Hegemaßnahmen würde die Lebensraumqualität wieder steigen lassen. Falls andere Faktoren (Landnutzung, Witterung…) den Zuwachs weiterhin klein halten, ist der Lebensraum langfristig ungeeignet und eine Bestandsstützung nicht gerechtfertigt. Doch wenn der Lebensraum nach Lebensraumverbesserungsmaßnahmen und verstärkter Raubwildbejagung wieder passt, würde auch die Bestandsstützung hinfällig, da ja unter diesen Bedingungen mit einem höheren Zuwachs zu rechnen ist.
Das Aussetzen würde also einen künstlichen Zuwachs darstellen, der dazu dienen könnte, das Populationswachstum zu beschleunigen und damit einen früheren, besseren Zustand des Fasanenbesatzes eher wieder herzustellen. Dies wäre auf den ersten Blick aus jagdwirtschaftlicher Sicht sinnvoll, kann doch der Jagdwert eines Reviers somit schneller erhöht werden. Im Sinne einer nachhaltigen Jagd müsste selbstverständlich im Jahr des Aussetzens auf die Fasanenjagd im Herbst verzichtet werden, eine unmittelbare Erhöhung des Jagdwertes bliebe also aus. Ob die Vorteile der Bestandsstützung tatsächlich eintreffen, hängt jedoch noch von zahlreichen weiteren Überlegungen ab. Schließlich kann bei falscher Strategie das Aussetzen von Volierenfasanen in Gebieten mit geringen Fasanendichten sogar den gesamten Besatz zunichtemachen. Doch dazu mehr im zweiten Teil in der Juniausgabe.